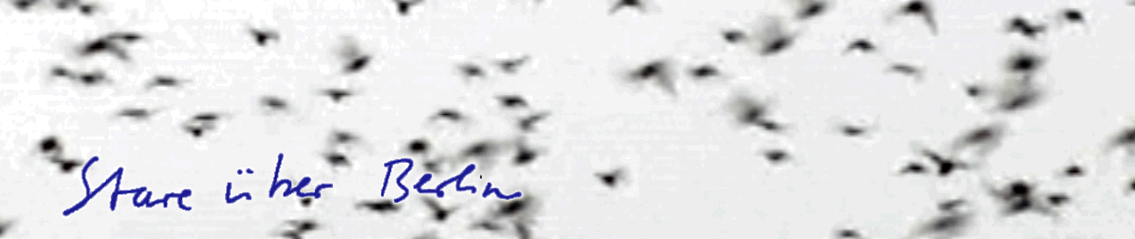Können Stare das Urheberrecht verletzen? Die Nachtigall von Reykjavík
Wolfgang Müller
Die berühmten Naturforscher Herr Spix und Martius, Verfasser des Werkes Reise in Brasilien, bemerken es als eine nicht uninteressante physiologische Untersuchung, in wie weit die musikalische Bildung der Menschen überhaupt schon auf die Tonkunst der Tiere gewirkt habe, und bemerken es als denkbar, daß viele der gefiederten Sänger Brasiliens verfeinerte Melodien hervorbringen würden, wenn einst die Wälder Brasiliens aufhörten, einen Widerhall der beynah unarti-culirten Töne halbwilder Menschen zu geben.
(Friedrich Faber: Über das Leben der hochnordischen Vögel, Leipzig 1826, S. 151. Exemplar der Sammlung der Präsenzbibliothek der Walther von Goethe Foundation)
Laut Angaben des britischen Vogelschutzbundes imitieren Stare, Drosseln und Amseln neuerdings Zivilisationsgeräusche, um ihren Balzgesang von dem anderer Männchen abzuheben und dadurch die Weibchen zu beeindrucken. Mike Everett, der Sprecher des Vogelschutzbundes sagte am Freitag im Independent, Singvögel hätten sich seit jeher durch Geräusche von Menschen inspirieren lassen. So hätten sie Bremsenquietschen und Handyklingeln in ihre Lieder eingearbeitet.
Die Tageszeitung, Berlin 19.5.2001
„Frühling kommt, der Sperling piept, Duft aus Blütenkelchen…”, sang einst Marlene Dietrich über eine Vogelstimme, die den nahenden Frühling ankündigt. Nun gilt der Haussperling, den sich der Komponist und Texter Friedrich Hollaender als Frühlingsboten erkor, nicht gerade als begnadeter Sangeskünstler. Sein Repertoire umfaßt eigentlich nur ein kurzes „errr“, „tetetetet“ oder das lautstarke „tschilp tschilp tschilp“. Andererseits hatte Hollaender möglicherweise den unbekannteren Vetter des Haussperlings, den Feldsperling, im Sinn, als er den Songtitel „Kinder, heut‘ Abend“ schrieb. Bald schon im Frühjahr sitzt nämlich das Feldsperlingsweibchen auf einem Baumzweig, flattert dabei ekstatisch mit den Flügeln und stößt zarte Lockrufe aus, die das Männchen anziehen sollen. Das ist für den Umworbenen sicher recht praktisch, denn im Gegensatz zum Hausspatz tragen Weibchen und Männchen des Feldsperlings ein nahezu gleiches Federkleid.
„Spatz im Trainingsanzug“ nennen die Holländer liebevoll die blau-gelb-grün-schwarz gezeichnete Blaumeise, die ebenfalls bei den ersten Sonnenstrahlen ihren Lockruf, ein hübsches glockenhelles „pink pink“, ertönen läßt. Blaumeisengesang enthält besonders viele Nach-ahmungen anderer Vogelstimmen. Das kleine Lied könnte sie also auch vom Buchfink gelernt haben, der ebenfalls gern „pink pink“ singt. Er erhielt deshalb übrigens seinen Beinamen „Fink“.
Aber auch im Winter, auf tiefverschneiten Tannen singt die Blaumeise „zizigä zizigä“. In den Sommermonaten, wenn Drosseln flöten, Rot-kehlchen trillern und Buchfinken jubeln, geht das Meisenpaar dagegen ziemlich stumm seiner Beschäftigung nach: Ein Dutzend und mehr Jungvögel gieren in der Nisthöhle nach Nahrung. Jeder Nistkastenbe-sitzer weiß, wie zerrupft und abgearbeitet die Altvögel nach zwei Wochen Jungenfütterung aussehen. Sicher hat das aber den Ruf der Meise als besonders nützlichen Vogel gestärkt. Von jeher galt sie zudem als ausgesprochen intelligent.
Sigurd, der Held aus der altisländischen Edda, gehört zu den ersten, die die Meisensprache entziffern konnten: So schneidet er dem getöteten Drachen mit seinem Wunderschwert das Herz aus dem Leib, um es zu grillen. Mit dem Finger kostet er vom Bratensaft, verbrennt sich den Finger und führt ihn zum Mund. Als das Drachenblut auf seine Zunge gelangt, versteht er die Vogelsprache. Es sind sechs Meisen, die ihm in der „Vogelweissagung“ einige nützliche Ratschläge für die Zukunft geben.
Zu zierliche Singvögel für das nationalsozialistische Deutschland: In einer voluminösen, kiloschweren Edda-Schweinsledersonderausgabe von 1943 werden aus den sechs Meisen des isländischen Originals kur-zerhand drei Adler: „Sigurd versteht die Adler“ untertitelt der Illustrator in runiger Schrifttype ein laffes Aquarell mit dem blondgelockten Helden, über dem drei Adler im Geäst thronen.
Heute zählen Wissenschaftler Meisen zu den Kleinvögeln mit dem höchsten Intelligenzquotienten. Seit englische Blaumeisen vor einigen Jahren entdeckt haben, daß sie lediglich die dünnen Aludeckel der morgendlich vor die Häuser gestellten Milchflaschen durchpicken müssen, um an den oben schwimmenden Rahm zu kommen, bleibt kein Deckel in England mehr heil. Die neue Nahrungsquelle sang sich sozusagen im Laufe von zwei Jahren bis nach Schottland herum. Ein wunderbares Thema für englische Biologen, die weltweit als führend in der Erfor-schung des Verhaltens von Blau- und Kohlmeisen gelten.
Als ausgesprochen dumm bezeichnete der Berliner Ornithologe und Tierpsychologe Oskar Heinroth dagegen vor siebzig Jahren die Nachtigall. Zwar hat er in seinen Schriften immer wieder darauf hingewiesen, daß es falsch wäre, Vögel moralisch zu bewerten, also vom „stolzen“ Kranich oder der „dummen“ Gans zu sprechen, andererseits die Nachtigall ohne Skrupel als „zu den dümmsten der Erdsänger“ gehörig gezählt. Als Beweis führte er an, daß er sie immer wieder mit einem Mehlwurm in den Käfig locken könne, selbst wenn die Käfigtür danach sofort geschlossen werde. Das sei jedem Vogel höchst unangenehm, der etwas Freiflug gewöhnt sei, meinte Heinroth. Als ob das Bedürfnis, statt im Käfig zu hocken, lieber im Zimmer eines Wissenschaftlers herumzufliegen, etwas mit Intelligenz zu tun hätte!
Das Nachtigallmännchen beginnt seinen legendären Frühlingsgesang gleich nach der Rückkehr aus Westafrika, gegen Ende April. In verwucherten Parkanlagen und verfransten Gebüschen fühlt sich der Vogel wohl und hebt zu extrem variationsreichen Gesängen an. Während Meeresvögel wie Möwen, Alken und Sturmtaucher durch die Verwen-dung besonders hoher Frequenzen die lautstarken Meereswogen übertönen, haben Vögel, die den verbuschten und daher besonders schallschluckenden Wald bewohnen, vorwiegend Stimmen entwickelt, die flötenähnlich klingen. Um als Individuen unverwechselbar zu bleiben bilden die Waldvögel zudem größere Repertoires und abwechslungsreichere Melodien aus.
„Im Anfang war die Nachtigall und sang das Wort züküht! züküht!“ dichtete Heinrich Heine im Jahr 1856. Tatsächlich ist der zurückhaltend gefärbte Vogel in der Lage, neben „züküht“ weitere zweihundert Strophentypen Strophen zu bilden, die Amsel besetzt mit dreißig den folgenden Platz.
Die „Sängerin der Nacht“, so die Übersetzung ihres Namens, jubiliert allerdings nicht nur nachts, ebenso gern und oft schluchzt sie auch am Tag.
Berlin nimmt bei der Erforschung des Nachtigallengesangs eine führende Rolle ein. In einem flachen Gebäude neben dem Botanischen Garten, dem Institut für Verhaltensbiologie, singen Nachtigallen auch zur Winterzeit. Auf die Frage, ob es sie nicht unwiderstehlich zu ihren Winterplätzen nach Westafrika zieht, entgegnet Silke Kipper: „Nein, nein. Die werden im Herbst zwar schon etwas zugunruhig, kleben aber durchaus nicht am Käfigdraht.“ Silke Kipper und Cord Riechelmann sind Doktoranden bei Kommunikationsforscher Dietmar Todt und der bekannten Nachtigallengesangsexpertin Professor Henrike Hultsch. Eine streng begrenzte Anzahl von Berliner Nachtigallen wird jedes Jahr kurz nach dem Ausschlüpfen der Berliner Wildnis, also dem Tiergarten oder Teufelsberg, entnommen und dem Institut zugeführt. „Die Nachtigall ist ein klasse Studienobjekt“, betont Silke Kipper. „Sie hören und merken sich den Gesang von ihrem Vater, fliegen dann nach Westafrika, um dort mit dem Subsong und später dem Plastiksong zu beginnen.“ Der Subsong wäre mit Kindergebrabbel vergleichbar, die Struktur, also Strophe – Pause – Strophe, sei noch nicht ausgebildet, der folgende Plastiksong ließe dann erste Strukturen erkennen.
Wissenschaftlern gilt die Entwicklungsgeschichte des Vogelgesanges als Modellsystem, das Ähnlichkeiten mit der frühen Phase der Sprach-entwicklung des Menschen aufweist. Wie das mit der Berliner Love Parade wäre, ob es nicht sein könnte, daß der baßlastige Umzug durch den Tiergarten die dort lebenden Vögel total verwirre. „Das ist schwer zu sagen“, erwidert Cord Riechelmann etwas vorsichtig, „klanglich jedenfalls nicht. Ihre Strophen haben sie zu dieser Zeit bereits gelernt. Die Parade findet ja im Hochsommer statt.“
Es scheint natürlich schwer vorstellbar, daß es dem versteckt lebenden Vogel gefällt, wenn eine riesige Masse glücklicher und ausgelassener Menschen zum Tanzen oder Pinkeln in sein Reich kommt. „Vernichtet sind die lieblichen Gebüsche, der dunkle Nachtigallenwald zerstört“, dichtete Wieland allerdings schon lange vor der Existenz der Love Parade.
Das Nachtigallenmännchen selbst ist allerdings auch nicht gerade zimperlich, wenn es darum geht, mit Gesang sein Revier zu markieren. Gemein fällt er den singenden Konkurrenten kurz vor dem Ende einer Strophe imitierend ins Wort – eine beliebte Methode, diesen zu verwirren.
„Der Nachtgesang lockt die Weibchen an, während der Tagesgesang der Markierung des Reviers dient“, erläutert Silke Kipper. Deshalb sei das Aufnehmen dieses Nachtgesanges für die Forscher immer auch ein Kampf mit der Zeit. Die letzten Nachtsänger des Jahres sind ledige Männchen, die mangels Attraktivität noch keine Partnerin gefunden haben. Die Weibchen bevorzugen nämlich besonders variationsreich singende Männchen. Daneben, so stellte die Nachtigallengesangsex-pertin Henrike Hultsch fest, spielt auch der Dialekt, der regionale Ausweis bei der Gunstgewinnung, eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Singen Vögel auch einfach so, aus Spaß und Freude? „Das ist ein altes unentschiedenes Problem“, meint Cord Riechelmann etwas zurückhaltend. Auf jeden Fall könnte es sein, daß das Singen auf den Sänger postiv zurückwirkt, seine Stimmung hebt. Das seien aber Hypothesen, die zur Zeit untersucht würden.
Im Institut selbst leben die einzelnen Vögel in großen Käfigen und hüpfen mit ihren langen Beinen und dem glatten rötlich-braun-grauen Gefieder elegant über die Sitzstangen. Gelegentlich stelzen sie mit dem Schwanz. Irgendwie machen sie einen etwas arroganten Eindruck. „Gesellig sind sie jedenfalls nicht“, sagt Silke Kipper und wirft einen Blick auf das etwas heller gefärbte Weibchen, „zwei männliche Vögel in einem Raum würden sich regelrecht an die Wand singen.“ Tatsächlich würden sie sich buchstäblich zu Tode singen, also so lange, bis der Konkurrent vor Erschöpfung von der Stange kippt. Auch für die Wissenschaftler ist so ein Duell ohne Ohrschutz nicht leicht zu ertragen. Ein sauber aufgenommener Nachtigallengesang mit seinen kristal-klaren, eindringlichen Höhen schmerzt ungemein, besonders auf CD. Je ein Männchen und ein Weibchen befinden sich deshalb getrennt in einem Raum. Um den Gesang zu notieren, werden im Institut Sonagramme erstellt, die die Möglichkeit bieten, Höhe, Zeitablauf und Tonqualität in Form eines Diagramms abzulesen.
Schon vor über hundert Jahren versuchten Ornithologen, die Gesänge in Noten oder Klangsilben wiederzugeben. Die Notierung in Klangsil-ben ist in populärwissenschaftlichen Vogelbüchern bis heute in Gebrauch. In dem Klassiker Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas notierte Johann Friedrich Naumann 1896 die Gesangsstrophen der Nachtigall wie folgt:
„Ih ih ih ih ih watiwatiwati!
Diwati quoi quoi quoi quoi quoi qui
ita lülülülülülülülülülü watiwatiwatih!
Gewisse Ähnlichkeiten zur Ursonate von Kurt Schwitters sind nicht von der Hand zu weisen, wenngleich der zündende Funke zur Entstehung dieses Kunstwerks ja laut offizieller Kunstgeschichte von Raoul Hausmanns Vortrag des dadaistischen Plakatgedichts fmsbwtözäupggiv?mü im Jahr 1921 gekommen sein soll. Mir dagegen erscheint es nicht unwahrscheinlich, daß ein Künstler wie Schwitters die weitverbreiteten Silbennotationen aus ornithologischen Werken gekannt und in modifizierter Form adaptiert hat.
Auf jeden Fall hat ein anderer, sehr imitationsbegabter Vogel seinerseits die Ursonate von Schwitters übernommen und wiederum in seinen Gesang integriert. Es handelt sich um den Star (sturnus vulgaris), genauer: um die Stare auf der kleinen norwegischen Insel Hjertøya im Moldefjörd, auf der Schwitters von 1932 bis zu seiner Flucht aus Norwegen jeden Sommer mehrere Monate verbrachte. Dort lebte er in einem winzigen Haus mit Frau Helma und Sohn Ernst. Bei meinem Besuch auf der Insel im Jahr 1997 entdeckte ich dieses überraschende Phänomen. Und da es auch Berichte von Augenzeugen gibt, die Schwitters‘ Begeisterung für das Rezitieren im Freien bestätigen, verstärkte sich meine Vermutung. So äußerte sich der mit dem Künstler eng befreundete Dadaist Hans Arp über eine solche Situation: „In der Krone einer alten Kiefer am Strand von Wyk auf Föhr hörte ich Schwitters jeden Morgen seine Lautsonate üben. Er zischte, sauste, zirpte, flötete, gurrte, buchstabierte.“
Erfreulicherweise ergab sich nun vor Ort in Hjertøya die Möglichkeit, diese Gesänge aufzunehmen und bei einer späteren Ausstellung mit dem Titel „Hausmusik – Stare von Hjertøya singen Kurt Schwitters“ dem Publikum als CD vorzustellen. Kurz darauf erhielt ich einen Brief aus dem Sekretariat des Verlages Kiepenheuer:
- Berlin-Dahlem, 8. September 2000
Betr.: URSONATE von Kurt SchwittersSehr geehrter Herr Müller,
per Zufall haben wir durch einen Zeitungsartikel von Ihrer CD-Produktion erfahren, auf der Sie „…mit dem Geschrei von Vögeln, die – so die Angabe – die Ursonate des dadaistisch inspirierten Künstlers Kurt Schwitters intonieren.“ Wir vertreten im Namen des DuMont Verlages das Werk von Kurt Schwitters, haben jedoch nach Durchsicht unserer Unterlagen nicht feststellen können, daß diese CD-Produktion von uns autorisiert worden ist. Bitte teilen Sie uns mit, von wem Sie die Genehmigung hierzu erhalten haben, damit wir der Sache nachgehen können.
Wir hoffen, bald von Ihnen zu hören und verbleiben
Mit freundlichen Grüßen
GUSTAV KIEPENHEUER
Bühnenvertriebs-GmbH
Zunächst hielt ich diesen Brief für einen Scherz, bis dann der Ton weite-rer Schreiben aus dem Haus Kiepenheuer drohender wurde. Es blieb keine andere Möglichkeit, als das Mißverständnis durch ein detailliertes Antwortschreiben aufzuklären. Dieses verließ mein Büro am 1. Juni 2001.
- Berlin, der 1. Juni 2001
Wolfgang Müller, Waldemarstr. 48
10997 BerlinKiepenheuer Bühnenvertriebs-GmbHFrau Kirstin Börgen/ G. Stergar
Schweinfurthstr. 60, 14195 BerlinSehr geehrte Frau Börgen,
herzlichen Dank für die Zusendung Ihres Briefes. Leider komme ich erst jetzt dazu, Ihnen zu antworten.
Tatsächlich scheinen die auf der einst von Kurt Schwitters (seit 1932) über zehn Jahre in den Sommermonaten bewohnten norwegischen Insel Hjertøya lebenden Stare das Werk des Künstlers zu rezitieren. Wie es aussieht, hat seinerzeit Kurt Schwitters auf der Insel lautstark seine Gedichte eingeübt und die Ursonate geprobt.
Ich konnte es bei meinem ersten Besuch im Juni 1997 zuerst auch nicht glauben, daß die bekanntlich imitationsbegabten Vögel unter anderem dadaistische Lautgedichte und die Ursonate von Schwitters intonierten. Selbstverständlich in ganz eigener Art, über die Generationen sozusagen von Star zu Star vermittelt. Zum Glück hatte ich seinerzeit ein Aufnahmegerät dabei und konnte deshalb als Beleg den Gesang der Stare von der Insel Hjertøya im Moldefjord mitschneiden.
In Berlin zurück spielte ich die Aufnahmen Herrn Prof. Dr. Börner vor. Herr Prof. Dr. Börner ist der Starengesangsspezialist Deutschlands und erforscht im Institut für Verhaltensbiologie an der Freien Universität seit langer Zeit speziell Starengesänge.
Anläßlich der Eröffnung meiner Ausstellung „Hausmusik – Stare auf Hjertøya singen Kurt Schwitters“ am 25. August 2000 in der Galerie Katze 5 in Berlin hielt er eine vielbeachtete Rede, in der er als Wissenschaftler bestätigen konnte, daß es tatsächlich möglich sei, daß die Stare von Hjertøya Teile und Elemente der Schwitterschen Dichtung aufgenommen und in ihr Gesangsrepertoire eingearbeitet hätten.
Diese Aussage schien für mich deshalb besonders wichtig, da einige Kritiker behaupteten, bei der meinem Katalog beiliegenden CD handele es sich um ganz gewöhnliche Starengesänge, die nicht im Entferntesten an Lautgedichte oder gar die Ursonate selbst erinnerten. Ja, man ging so weit zu sagen, ich sei Opfer meiner allzu großen Phantasie geworden.
Da es sich bei der CD-Produktion um Vogelstimmenaufnahmen und nicht um eine Komposition von mir handelt, erhielt ich von der GEMA eine Sondergenehmigung diese als „Naturgeräusche“ anzumelden. Es sind also, wie gesagt, reine Dokumentaraufnahmen. Keinesfalls habe ich, wie sie aus einem Zeitungsartikel zitieren, „mit dem Geschrei von Vögeln die Ursonate intoniert.“ Ich muß Ihnen gestehen, daß ich so etwas auch für ausgesprochen peinlich hielte.
Um Ihre Frage also zu beantworten, möchte ich auf die Stare in Hjertøya verweisen, die von urheberrechtlichen Bestimmungen natürlich nicht die geringste Ahnung haben. Es könnte aber durchaus sein, daß in der Zukunft noch mehr imitationsbegabte Vogelarten urheberrechtlich geschützte Werke von Kurt Schwitters und anderen imitieren und interpretieren, ohne zuvor eine Genehmigung bei der Kiepenheuer Bühnenvertriebs GmbH einzuholen. Ich lege Ihnen einen aktuellen Zeitungsausschnitt über das Imitieren von Handyklingeln und Bremsenquietschen durch Amseln, Drosseln und Stare und eine Bemerkung des Naturforschers Faber von 1826 über Vögel im brasilianischen Urwald bei, die durch das unartikulierte Geschrei der Ureinwohner auf unangenehme Art inspiriert worden seien.
Wenn Sie Pläne fassen, das Urheber- und Aufführungsrecht für Kunstwerke musikalischer und darstellender Art auch auf Tiere selbst, in diesem Fall imitationsbegabte Vögel auszuweiten, würde mich das persönlich sehr interessieren. Ich bin jederzeit bereit, Ihnen dazu entsprechendes Material und Belege zu liefern. Selbstverständlich würde ich mich in einem solchen Fall über eine kleine Aufwandsentschädigung für meine Mühen freuen.Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne jederzeit direkt an mich wenden. Ich verbleibe in geschätzter Hochachtung
Wolfgang Müller
Der Star unterscheidet sich vom Amselmännchen durch den kürzeren Schwanz und den größeren Glanz im Gefieder. Außerdem schreiten Stare, während Amseln hüpfen. In etwa der gleichen Zeit, in der Schwitters die ersten Töne der Ursonate komponierte, hat übrigens auch Robert Musil seinen Text Die Amsel geschrieben. Wunderbare Nachtigallentöne sitzen da auf dem First des Nachbarhauses und springen in die frühmorgendliche Berliner Luft wie Delphine. Oder erscheinen wie Leuchtkugeln beim Feuerwerk, die an den Fenster-scheiben zerplatzen und als große Silbersterne in die Tiefe sinken. Schließlich entpuppt sich der Sänger in Musils Erzählung als gewöhnliche Amsel, die lediglich die Strophen der Nachtigall imitiert.
Dem nachtigallosen Island ist deshalb die Amsel eine wunderbare Erscheinung. Im Jahr 1992 verschlug es eine Handvoll dieser Vögel auf die Insel. „Turdus merula brütet seitdem regelmäßig in Reykjavik“, bestätigt Vogelexperte Gudmundur Gudmundsson vom Nationalen Naturkundemuseum: „Es gibt auf Island sehr viele Meeres- und Wattvögel, aber relativ wenige Singvögel. Amsel und Feldsperling sind da eine echte Bereicherung.“ Der Sperling als Bereicherung? „Ja, seit neun Jahren brütet auch dieser Singvogel regelmäßig hier“, Gudmundur Gudmundsson lacht freundlich, „Nein, nein – nicht in Reykjavik, sondern im Südosten, auf einer Farm namens Hof. Rund um die Farm leben etwa fünfzehn Sperlinge – die Sensation nicht nur für Ornithologen. Ein Besuch bei der einzigen isländischen Sperlingskolonie gilt auch den Bewohnern der Eis- und Vulkaninsel als ganz besondere Attraktion.
Teile des Textes wurden in folgenden Publikationen veröffentlicht:
Wolfgang Müller, Die Nachtigall singt Dadada, die tageszeitung 4./5. 4. 1998 Hausmusik – Stare von Hjertoya singen Kurt Schwitters, Galerie katze 5, Berlin 2000 Die Nachtigall von Reykjavík, SuKuLTuR 025, 2004
Wolfgang Müller, Neues von der Elfenfront. Die Wahrheit über Island, edition suhrkamp, Frankfurt 2007: Wie Schwitters Ursonate nach Island kam, S. 58 – 68.